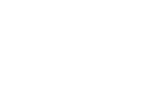Bei der Unteren Naturschutzbehörde des Märkischen Kreises arbeitet ein Team, das unermüdlich im Wald auf Spurensuche geht. Gesucht werden keine Opfer oder Verbrecher, so wie in einem Krimi, sondern Wölfe. Das Team ist Teil eines immer größer werdenden Netzwerks aus Akteuren, die ein professionelles Wolfs-Monitoring garantieren. |
Sie sind oft im Wald. Das Wetter spielt für sie keine Rolle. Regen, Schnee, Sturm oder sengende Hitze – all das hindert die Fachleute nicht an ihrer Arbeit. Im Gegenteil: Sie freuen sich auch über Kälte und eine geschlossene Schneedecke. Dadurch werden Spuren besonders gut sichtbar. Das ist wichtig für ihre Aufgabe: Spuren des Wolfsrudels im Ebbegebirge zu finden.
Wichtige Beweismittel sind Fußabdrücke im Matsch, Losungen, also der Kot des Wolfes, oder auch Fotos von Wildkameras. „Es ist wie ein Puzzle“, berichtet eine Expertin der Unteren Naturschutzbehörde des Märkischen Kreises. „Jeder Hinweis bringt uns ein Stück weiter, welches Tier wo und wann unterwegs war.“ Ihr Ziel ist es, die Anzahl der Wölfe zu dokumentieren, aber auch ihr Verhalten und ihren Bewegungsradius besser zu verstehen. Deshalb ist das Monitoring-Team ständig auf der Suche nach neuen Hinweisen, um den Aufenthalt der Tiere im Ebbegebirge nachzuvollziehen.
Eines der wichtigsten Hilfsmittel des Wolfsmonitorings sind die insgesamt 14 Wildkameras, die strategisch in den Wäldern des Ebbegebirges platziert worden sind. Mehrere Hunderttausend Bilder sind so in unzähligen Stunden bereits ausgewertet worden. Diese unscheinbar getarnten Geräte mit moderner Technik reagieren auf Wärme und machen automatisch Fotos. Natürlich liefern die Kameras nicht nur Bilder von Wölfen. Auch andere Tiere wie Rehe, Füchse, Wildschweine und sogar Wildkatzen sind zu sehen. „Manchmal sind die Bilder unscharf und die Tiere nur schemenhaft zu erkennen“, erklären die Experten. Umgekehrt gibt es aber auch die klaren, gestochen scharfen Aufnahmen – auch vom Wolf, der vor die Kamera läuft. Zuletzt wurden eindeutige Bilder Ende März morgens um 6 Uhr aufgenommen. Darauf zu sehen sind sogar zwei Wölfe.
Genetische Analyse von Losungen
Die Aufnahmen sind wertvoll für die Dokumentation des Wolfsrudels im Ebbegebirge. „Sie sind eine wichtige Informationsquelle und helfen uns, die Bewegungen der Wölfe nachzuvollziehen.“ Doch nicht nur Bilder und Fotos geben Aufschluss über das Rudel. Auch die genetische Analyse von Losungen und anderen Spuren sind ein wichtiger Bestandteil des Monitorings. „Wenn wir Kot oder andere Spuren finden, sammeln wir sie ein und senden sie an das LANUK, also an das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen“, erklärt die Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde. Dort werden die Proben auf ihre genetische Identität untersucht. Das LANUK verifiziert die gesammelten Daten und stellt sicher, dass die Informationen korrekt und wissenschaftlich fundiert sind. Dies nimmt allerdings auch eine entsprechende Bearbeitungszeit in Anspruch, auf die die Untere Naturschutzbehörde keinen Einfluss hat.
Enge Kooperation mit Wolfsberatern, Nutztierhaltern, Experten von Wald & Holz
Ein besonders wichtiger Teil des Monitorings ist die enge Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren, darunter auch Wolfsberatern und Nutztierhaltern. Förster vor Ort helfen zudem dabei, Spuren und gegebenenfalls strategisch kluge Orte für die Wildtierkameras zu finden. Landwirte spielen eine zentrale Rolle, wenn es um den Schutz von Nutztieren geht. Auch die Experten von Wald und Holz NRW sind unverzichtbar. „Diese Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort wird immer besser und ist der Schlüssel für unser Monitoring“, erläutert die Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde, die auch Luchs- und Wolfsberaterin ist. Bei Nutztier- und Wildtierrissen sei es wichtig, schnell und sachkundig zu handeln, um Missverständnisse zu vermeiden. Alle Akteure – von den Förstern über die Landwirte bis hin zu den Jägern – würden immer öfter ihre Erkenntnisse teilen und gemeinsam nach Lösungen suchen.
Ziele des Monitorings
Das Wolfsmonitoring im Märkischen Kreis verfolgt allen voran folgende Ziele: Zum einen geht es darum, die Zahl der Wölfe in der Region genau zu erfassen. Aktuell nachgewiesen ist ein Wolfsrudel im Ebbegebirge. Zum anderen soll das Verhalten der Tiere untersucht werden, um besser zu verstehen, wie sich die Wölfe in ihrer natürlichen Umgebung bewegen und welche Gebiete sie bevorzugen. Die Arbeit des Monitoring-Teams wird nicht nur im Märkischen Kreis geschätzt, sondern auch auf Landesebene. Das LANUK hat den Kreis mehrfach für seine Arbeit gelobt.
Gesetzgebung auf übergeordneten Ebenen
Der Umgang mit Wölfen unterliegt klaren gesetzlichen Regelungen, die auf EU-, Bundes- und Landesebene festgelegt sind. Diese Gesetze sollen den Wolf schützen, gleichzeitig aber auch den Dialog zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Gesellschaft fördern. Der kürzlich beschlossene Beschluss zur Absenkung des Schutzstatus nach der Berner Konvention, der am 7. März 2025 in Kraft trat, könnte eine Neubewertung auf EU-Ebene ermöglichen. Ein solcher Schritt würde jedoch einen einstimmigen Ratsbeschluss erfordern.
Für den Märkischen Kreis bleibt die Zusammenarbeit mit Landwirten, Jägern und Fachbehörden weiterhin der Schlüssel zum erfolgreichen Monitoring. „Es ist ein langfristiger Prozess“, sagt das Monitoring-Team und ergänzt: „Wir sind auf einem guten Weg.“
Fotos, Videos und Hinweise gerne senden
Beim Märkischen Kreis können Hinweise, Fotos und Videos unter folgender E-Mail-Adresse weiterhin verschickt werden: wolf@maerkischer-kreis.de . Wolf-Sichtungen – insbesondere frische Losungsfunde, aber auch Fotos oder Videos – bitte möglichst zeitnah übermitteln. Auch die Jägerschaft wird gebeten, ihre Erkenntnisse weiterzugeben. Die Untere Naturschutzbehörde leitet relevante Informationen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW (LANUK) weiter.